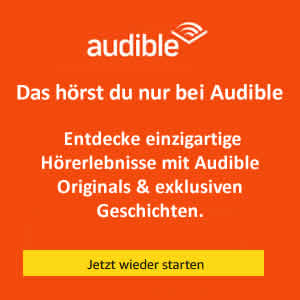Europas Klimaziel 2040: Die Wissenschaft drängt – die Politik zögert
Mehr als 2.000 Forscherinnen und Forscher aus Europa fordern die EU-Spitze in einem offenen Brief auf, beim 2040-Klimaziel nicht von der Evidenz abzuweichen. Ihr Appell ist unmissverständlich: Eine Senkung der Treibhausgasemissionen um 90 bis 95 Prozent gegenüber 1990 sei keine politische Kür, sondern eine existenzielle Notwendigkeit – und ökonomisch eine Chance.
Die Kommission hat im Sommer eine Änderung des EU-Klimagesetzes vorgeschlagen, die ein –90-Prozent-Ziel bis 2040 festschreibt. Dieses Ziel ist als Leitplanke auf dem Weg zur Klimaneutralität 2050 gedacht und soll die nächste EU-Einreichung im Rahmen des Pariser Abkommens prägen. Doch zentrale Details – etwa der Umgang mit internationalen Klimazertifikaten – sind politisch umkämpft.
Streitpunkt Offsets
Wenig zimperlich fällt das Urteil der europäischen Klima-Berater aus: Internationale Offsets sollten nicht auf das 2040-Ziel angerechnet werden. Sie verwässerten die inländische Minderung, schafften Fehlanreize und gefährdeten Investitionen in Europas Wettbewerbsfähigkeit. Mehrere Analysen warnen zudem vor Greenwashing-Risiken und Unklarheiten bei schwammigen Anrechnungsregeln, die je nach Auslegung stark variierende Kompensationsmengen erlaubten.
Politische Geometrie vor COP30
Kurz vor der Weltklimakonferenz COP30 (10.–21. November 2025, Belém) ringen die Mitgliedstaaten um eine gemeinsame Linie. Der Rat hat zwar seine COP-Position abgesteckt, die Entscheidung zum 2040-Ziel aber abermals vertagt – ein Signal der Uneinigkeit, das die Verhandlungsmacht Europas schwächt. Länder mit hoher Industrie- und Energiepreis-Sensibilität drängen auf Flexibilitäten, andere auf Stringenz ohne Schlupflöcher. Der Zeitplan ist knapp.
Ökonomie der Ambition
Die Forscherschaft verweist nicht nur auf Kipppunkt-Risiken, sondern auch auf Standortvorteile: Ein klarer, überwiegend inländischer Dekarbonisierungspfad kann Strompreise stabilisieren, Importe fossiler Energien reduzieren und neue Industrie-Jobs schaffen – von Netzen über Speicher bis zur Prozesswärme. Entscheidend ist Investitionssicherheit: Ein Ziel mit Hintertüren lenkt Kapital in Kompensationen statt in europäische Wertschöpfungsketten.
Was jetzt ansteht
Für die Union ist das 2040-Ziel mehr als Symbolik. Es bestimmt den 2035-Pfad im Pariser Rahmen und die Architektur von ETS, Lastenteilung, Industriepolitik und Netzausbau der kommenden Jahre. Ohne belastbare Einigung droht Europa in Belém mit halbfertigen Zusagen aufzutreten – und der Vorwurf, sich vom wissenschaftlichen Kompass zu entfernen, bekäme zusätzliche Nahrung.
Fazit
Die Kontroverse dreht sich nicht um das „ob“, sondern um das „wie“ der europäischen Dekarbonisierung. Die Evidenz favorisiert ein klares –90-Prozent-Ziel bis 2040, ohne internationale Anrechnungen. Politisch ist das unbequem, industriepolitisch aber folgerichtig: Wer Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und Klimaschutz zusammendenkt, setzt auf Inlandsinvestitionen statt Zertifikate – und gewinnt damit Zeit, Glaubwürdigkeit und Technologie-Substanz. Jetzt braucht es Entschlusskraft.