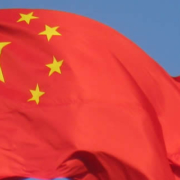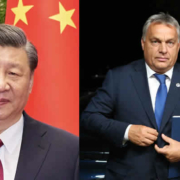Huawei und die Trump-Strategie: Ein Bumerang für Washington
Ein Lehrstück aus China
Als die Regierung von Donald Trump im Mai 2019 Huawei auf die Schwarze Liste setzte, klang das nach einer klaren Botschaft: So nicht, China. Die USA wollten ein Exempel statuieren, Huawei als geopolitisches Werkzeug entwaffnen und zugleich die eigene technologische Vorherrschaft sichern. Doch heute, fünf Jahre später, steht Huawei wieder erstaunlich stark da. Der chinesische Konzern zeigt, warum der von Trump eingeschlagene Weg nicht nur ins Leere läuft, sondern potenziell sogar kontraproduktiv ist.
Der Plan war simpel: Mit Exportverboten und Sanktionen sollte Huawei der Zugang zu US-Technologien abgeschnitten werden – von Chips bis Software. Der sofortige Schaden war beträchtlich, der Umsatz des Unternehmens brach um ein Viertel ein, der internationale Smartphone-Marktanteil schrumpfte. Doch Huawei ließ sich nicht zerschlagen. Im Gegenteil: 2024 rechnet der Konzern mit einem Jahresumsatz von 860 Milliarden Yuan (rund 118 Milliarden US-Dollar) – fast wieder auf Vor-Sanktions-Niveau.
Der Aufstieg von HarmonyOS
Das Herzstück der Huawei-Renaissance heißt HarmonyOS. Was als Notlösung ohne Google begann, ist inzwischen ein ambitioniertes Ökosystem, das längst über Smartphones hinausreicht. Die neueste Version, HarmonyOS Next, kommt erstmals ohne US-Technologie aus und läuft in China bereits auf einer Milliarde Geräten – vom Handy über Autos bis zu smarten Haushaltsgeräten. BMW will das System ab 2026 in seinen E-Autos verbauen, McDonald’s und Emirates entwickeln eigene Apps. Und auf dem Heimatmarkt hat Huawei Apple 2024 als führenden Smartphone-Anbieter abgelöst.
Der nächste Schritt ist bereits in Sichtweite: Huawei will HarmonyOS als dritte große mobile Plattform weltweit etablieren, neben Android und iOS. Es ist ein Vorhaben, das nicht nur technologische, sondern auch politische Sprengkraft hat.
Sanktionen als Innovationsbeschleuniger
Die Geschichte, die sich hier abzeichnet, ist brisant. Denn das Sanktionsregime der USA erweist sich als Innovationsbeschleuniger für China. Handelsbeschränkungen, so scheint es, treiben Unternehmen wie Huawei dazu, Abhängigkeiten abzuschütteln und eigene Technologien voranzutreiben.
Ein aktuelles Beispiel liefert der KI-Sektor. Die US-Regierung hat die Lieferung bestimmter Nvidia-Chips nach China untersagt – Huawei kontert mit dem eigenen KI-Chip Ascend 910C. Der Chip ist für sich genommen schwächer als Nvidias Blackwell-Flaggschiff, doch Huawei setzt auf schiere Masse: Mehr Chips bedeuten mehr Gesamtleistung, wenn auch um den Preis eines vierfach höheren Energieverbrauchs.
Sicherheitsbedenken, die zurückkehren
Ironie der Geschichte: Während die USA Milliarden investieren, um Huawei-Komponenten aus ihren Netzwerken zu verbannen (geschätzte Kosten: fünf Milliarden Dollar), könnte HarmonyOS über die Softwareseite wieder Einzug halten – samt aller geopolitischen Risiken. In Deutschland wird bereits mit 2,5 Milliarden Euro kalkuliert, um Huawei-Technik aus sensiblen Netzen zu entfernen. Doch wenn chinesische Software auf westlichen Geräten läuft, ist das Problem längst nicht gelöst.
Trumps Erbe, Bidens Dilemma
Was als kraftvolle Machtdemonstration begann, hat sich für Washington zu einem strategischen Dilemma entwickelt. Trumps Nachfolger Joe Biden hat die Huawei-Politik seines Vorgängers weitgehend fortgeführt, doch die Wirkung verpufft zunehmend.
Der Fall Huawei wirft grundsätzliche Fragen auf: Wie wirksam sind Sanktionen in einer globalisierten Welt, in der technologische Innovation immer schneller stattfindet? Und können Handelshemmnisse ein Land auf Dauer wirklich kleinhalten – oder treiben sie es nicht vielmehr dazu, eigene Stärken zu entwickeln?
Das Lehrstück aus Peking
Huawei ist heute mehr als nur ein Konzern – es ist ein Symbol für Chinas Fähigkeit, auf Druck nicht mit Resignation, sondern mit Gegenangriff zu reagieren. Die Botschaft nach Washington: Wer glaubt, sich durch Sanktionen technologische Dominanz sichern zu können, könnte bald feststellen, dass er nur den eigenen Vorsprung verspielt.
Es ist ein Lehrstück über die Grenzen wirtschaftlicher Abschottung – und ein Bumerang, der in Washington mit wachsender Geschwindigkeit zurückzufliegen droht.