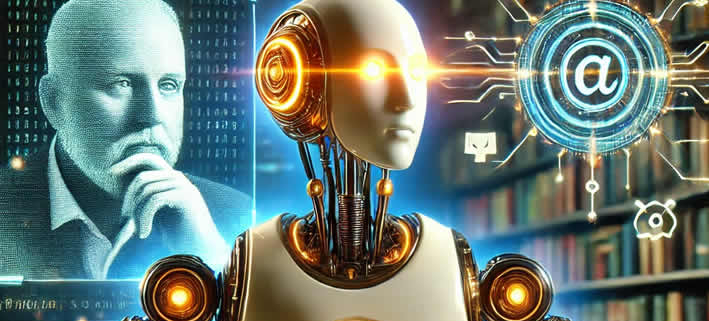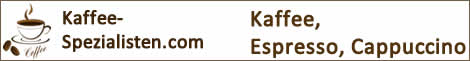Trump plant neue KI-Regulierung: Streit um Urheberrecht eskaliert
Die US-Regierung unter Donald Trump plant eine Neuregulierung der künstlichen Intelligenz (KI) und steht dabei vor einer zentralen Debatte: Wie soll mit urheberrechtlich geschütztem Material umgegangen werden? Während große US-Tech-Konzerne wie OpenAI und Google umfassende Ausnahmen fordern, um KI-Modelle effizient zu trainieren, wehren sich Autoren und Verlage gegen eine Nutzung ihrer Werke ohne Lizenzgebühren.
Trumps neuer KI-Aktionsplan: Weniger Regeln, mehr Konkurrenzschutz
Unter Trumps Vorgänger Joe Biden wurden bereits erste strenge Regelungen zur KI-Entwicklung eingeführt – allerdings per „Executive Order“ und nicht als Gesetz. Dadurch kann Trump diese Vorschriften nun relativ einfach wieder aufheben und einen eigenen „nationalen KI-Aktionsplan“ entwickeln. Ziel ist es, die Position der USA im globalen KI-Wettbewerb zu stärken und insbesondere China als Konkurrenten auszubremsen.
Diesen politischen Kurs nutzen KI-Firmen, um eigene Interessen durchzusetzen. OpenAI etwa fordert einen Freibrief für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte aus dem Internet. Noch ist in den USA nicht endgültig geklärt, ob das Training von KI mit solchen Daten unter das Prinzip des „Fair Use“ fällt – also eine zulässige Nutzung ist – oder ob Lizenzgebühren an Rechteinhaber gezahlt werden müssen.
OpenAI: Urheberrecht als Bedrohung der nationalen Sicherheit?
OpenAI argumentiert, dass die aktuellen Urheberrechtsregelungen zu strikt seien und die Innovationskraft der US-KI-Industrie behinderten. Das Unternehmen warnt, dass eine zu starke Regulierung den technologischen Vorsprung der USA gefährden könnte. Besonders China sei in der Lage, sich ungehindert im Internet zu bedienen, während US-Unternehmen mit rechtlichen Hürden kämpfen müssten.
In einer offiziellen Stellungnahme bekräftigte OpenAI patriotische Argumente: „Die Anwendung der Fair-Use-Doktrin auf KI ist nicht nur eine Frage der amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit – es ist eine Frage der nationalen Sicherheit.“ Konkret bezieht sich das Unternehmen auf den chinesischen Konkurrenten DeepSeek, dessen Fortschritte als Beweis für eine schrumpfende US-Führungsposition in der KI-Entwicklung gesehen werden. OpenAI fordert daher nicht nur Freiheiten beim Datenzugriff, sondern auch ein Verbot chinesischer KI-Modelle in den USA.
Tech-Konzerne gegen Verlage: Der Kampf ums Copyright
Google unterstützt eine ähnliche Linie wie OpenAI und betont, dass KI-Entwicklung schnelle und ungehinderte Nutzung öffentlich zugänglicher Inhalte erfordert. „Diese Ausnahmen ermöglichen die Nutzung urheberrechtlich geschützten, öffentlich verfügbaren Materials für das KI-Training, ohne die Rechteinhaber wesentlich zu beeinträchtigen“, argumentiert das Unternehmen. Langwierige Lizenzverhandlungen könnten Innovationen bremsen.
Doch zahlreiche Verlage und Autorenverbände wehren sich. Die „New York Times“ hat bereits 2023 Klage gegen OpenAI eingereicht, weitere Medienhäuser erwägen ähnliche Schritte. Auch unabhängige Autoren, deren Werke in KI-Trainingsdaten verwendet wurden, ohne dass sie davon profitierten, planen juristische Maßnahmen.
Google hat deshalb inzwischen eine „Anti-Copyright-Garantie“ eingeführt: Sollten Nutzer der Google-KI aufgrund urheberrechtlicher Verstöße verklagt werden, übernimmt der Konzern die damit verbundenen Rechtsrisiken.
Warum das Urheberrecht essenziell ist
Während die großen KI-Konzerne auf uneingeschränkten Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Inhalte drängen, ist die Bedeutung des Urheberrechts nicht zu unterschätzen. KI-Modelle sind auf große Mengen an Texten, Bildern und anderen Daten angewiesen – doch diese Inhalte wurden von Menschen erstellt, die ihre Arbeit als Einkommensquelle benötigen.
Ohne diese Inhalte wäre keine KI leistungsfähig. Zeitungsartikel, Bücher, wissenschaftliche Arbeiten oder Musik – all diese Werke wurden von Autoren, Journalisten, Forschern und Künstlern geschaffen, die für ihre Leistungen entlohnt werden müssen. Wenn Unternehmen wie OpenAI oder Google die Inhalte nutzen, ohne dafür zu zahlen, riskieren sie, dass Kreative und Verlage wirtschaftlich geschwächt werden und in Zukunft weniger Inhalte produzieren.
Langfristig könnte eine zu großzügige Interpretation des „Fair Use“-Prinzips dazu führen, dass qualitativ hochwertige Inhalte seltener werden, da die Urheber nicht mehr von ihrer Arbeit leben können. Das würde paradoxerweise auch den KI-Unternehmen selbst schaden, da ihre Modelle ohne neue, hochwertige Trainingsdaten an Qualität verlieren.
Europäische Regelungen: Lizenzverträge statt Freibrief
In Europa geht die Debatte in eine andere Richtung. Die EU-Kommission hat eine Ausnahmeregelung für sogenanntes „Data Mining“ zu Forschungszwecken im Urheberrecht verankert. Ob diese auch für große Konzerne gilt, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Gleichzeitig schließen Verlage und Verwertungsgesellschaften zunehmend Lizenzverträge mit US-Konzernen, um die Nutzung von Inhalten für KI-Trainingszwecke zu regulieren.
Die deutsche VG Wort bietet seit November 2023 eine eigene KI-Lizenz an, die es Unternehmen ermöglicht, Texte legal für das KI-Training zu nutzen.
Musk und Trump: Einflussreiche Verbindungen im KI-Sektor
Ein besonderes Interesse an der Neugestaltung der KI-Regulierung hat auch Elon Musk. Der Unternehmer, der als enger Berater Trumps gilt, besitzt mit seinem Start-up xAI einen eigenen KI-Konkurrenten zu OpenAI. Er hat ebenfalls ein starkes wirtschaftliches Interesse daran, dass KI-Trainingsdaten möglichst günstig oder kostenlos bleiben.
Auch sein Unternehmen X (ehemals Twitter) nutzt inzwischen Nutzerbeiträge, um das hauseigene KI-Modell „Grok“ zu trainieren. Google wiederum hat bestätigt, dass einige KI-Modelle mit Inhalten von YouTube trainiert wurden – wobei das Unternehmen betont, dass dies im Rahmen von Vereinbarungen mit YouTube-Erstellern geschehe.
Ungeklärt ist derzeit, wie Trumps Regierung die „Fair Use“-Regelungen im Kontext der KI-Industrie neu interpretieren wird. Sollte der Präsident den Ratschlägen von Musk und den Tech-Riesen folgen, könnten Urheber in den USA künftig noch größere Schwierigkeiten haben, am KI-Boom finanziell zu partizipieren.