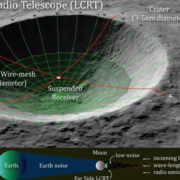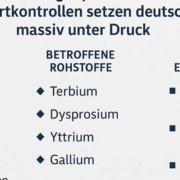Europas verwundbare Lieferkette: Wie China die Seltenen Erden dominiert – und was Kiruna, Brasilien und die USA dagegenstellen
In Schwedens Bergwerkstollen wird EU-Industriepolitik zur Chefsache. Doch während Brüssel Ziele setzt, sichern sich die USA integrierte Lieferketten – und Peking dreht an der Export-Schraube. Europas Zeitfenster schrumpft.
Die Szene unter Tage – und die eigentliche Front
Bläuliches Licht im Stollen von Kiruna, 500 Meter Fels über den Köpfen: EU-Vize Stéphane Séjourné und Schwedens Wirtschaftsministerin Ebba Busch beugen sich über ein virtuelles Relief. Das Bild erzählt bereits die größere Geschichte: Der Konflikt um Seltene Erden wird nicht mit Kanonen ausgetragen, sondern mit Exportkontrollen, Zöllen und Abnahmeverträgen. Kiruna steht für Europas Hoffnungen – und für den langen Weg von der Lagerstätte zur Lieferkette.
Pekings Machtinstrument
Seltene Erden sind nicht wirklich selten – aber ihre Gewinnung und vor allem die Raffination sind komplex, teuer und ökologisch heikel. Genau hier hat China über Jahrzehnte einen Vorsprung aufgebaut. Die Folge: Der Großteil der globalen Raffination, nahezu alle „schweren“ Seltenen Erden und damit die Schlüssel für Hochleistungsmagnete liegen in Pekings Hand. Neue Exportauflagen und Genehmigungspflichten treffen westliche Kernbranchen – E-Mobilität, Windkraft, Wehrtechnik – mitten in der Skalierungsphase.
Europas Selbstanspruch – und die Lücke zur Realität
Mit dem Critical Raw Materials Act (CRMA) hat die EU ambitioniert vorgelegt: Bis 2030 zehn Prozent des Bedarfs selbst fördern, 40 Prozent in Europa verarbeiten, 25 Prozent recyceln, und höchstens 65 Prozent Abhängigkeit von einem einzigen Drittstaat pro Rohstoff. Der Status quo liegt davon weit entfernt: kaum Raffineriekapazitäten, schleppende Genehmigungen, fragmentierte Projektpipelines. Kiruna ist strategisch – aber ohne schnelle Zulassungen, Abnahmegarantien und nachgelagerte Magnetfertigung bleibt es Symbolpolitik.
Kiruna: Potenzial mit langer Rampe
Schwedens Per-Geijer-Lagerstätte birgt Schätzungen zufolge große Mengen Seltenerdoxide – und liegt in einer Region mit Bergbau-Infrastruktur. Doch die Hürden sind handfest: Umwelt- und Bergbaugenehmigungen, Verlagerungsfolgen für die Stadt, die Belange der Sámi-Rentierpfade. Selbst optimistisch gerechnet wird der Abbau Jahre brauchen. Ohne parallelen Aufbau von Raffination und Magnetproduktion in Europa droht das klassische Rohstoff-Dilemma: Export von Konzentraten, Import von Wertschöpfung.
USA: Tempo durch Staatsaufträge
Mountain Pass zeigt, wie schnell es gehen kann, wenn Industriepolitik nicht nur im Gesetzblatt steht. Mit staatlicher Kofinanzierung, festen Abnahmeverträgen (Automobil, Verteidigung) und klaren Meilensteinen entsteht eine integrierte Kette – von Erz über Raffination bis zum Magneten. Die Marktwirtschaft macht dort bewusst Platz für Planbarkeit.
Brasilien: Das geologische „Einhorn“
Rund um Poços de Caldas setzen Projekte auf tongebundene Lagerstätten, die sich mit deutlich milderen Verfahren auslaugen lassen. Politisch ist Brasilien anschlussfähig, die EU ist Wunschpartner – noch. Auch Washington und Peking werben. Wer hier früh Offtake-Deals, Technologiekooperationen und ESG-Standards bindet, gewinnt Jahre statt Monate.
Drei Wege – und warum kein einzelner reicht
- Strategische Vorräte: Sinnvoll, aber ohne Materialflüsse wenig skalierbar; China begrenzt Exporte zunehmend feinjustiert.
- Handelsabkommen: Notwendig, doch langsam; viele Partner sind selbst in chinesische Wertschöpfung verstrickt.
- Eigenaufbau in Europa: Der Schlüssel – sofern Genehmigungen, Finanzierung und Abnahme gesichert sind und Recycling mitdenkt.
Was jetzt konkret passieren muss
- Abnahmegarantien und Preisbänder: Contracts for Difference für Raffination und Magnetfertigung, um Chinas Preisdruck zu neutralisieren.
- One-Stop-Permitting mit Fristen: CRMA-Schnellspuren real operabel machen – verbindliche Maximaldauern, abgestimmte Umweltstandards, frühe Beteiligung lokaler Communities.
- Geordnete Offtakes außerhalb Chinas: Brasilien, Australien, Kanada, Indonesien – kombiniert mit Technologie- und ESG-Konditionen, um „Dirty Processing“ zu vermeiden.
- Recycling skalieren: Sammelquoten für Motoren und Windturbinen, Design-for-Recycling-Standards, Aufbau von Magnet-Recycling in der EU.
- Nachfrageseitige Resilienz: Förderung magnetarmer Motor-Topologien, Effizienz-Software, Komponentenstandardisierung – weniger Dysprosium/Terbium-Bedarf pro Kilowatt.
- Sicherheitsrelevante Reserven: Vorratshaltung auf Komponentenebene (Magnete/Legierungen) für die Verteidigungs- und Netzinfrastruktur.
Der blinde Fleck: Akzeptanz und Ökologie
Wer in Europa fördert und raffiniert, muss besser sein als das, was man kritisiert: sauberes Wasser-/Abfall-Management, Tailings-Sicherheit, Transparenz über den gesamten Lebenszyklus. Beteiligung und Benefit-Sharing mit Betroffenen – gerade in Kiruna – sind kein „Nice-to-have“, sondern Zeitgewinn.
Ausblick
Europa steht nicht an der Rohstoff-, sondern an der Industrieketten-Front. Kiruna kann Anker werden, Brasilien ein zweites Standbein, die USA ein Benchmark. Entscheidend ist, ob Brüssel und die Hauptstädte binnen Monaten – nicht erst in Jahren – Preis- und Abnahmeinstrumente aufsetzen, Genehmigungen beschleunigen und Recycling großziehen. Sonst bleibt Europa Statist – in einem Rennen, das andere längst gestartet haben.