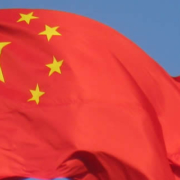Chinas langer Arm: Wie Peking weltweit Wissen abgreift
Von den Laboren deutscher Universitäten bis zu den Werkshallen amerikanischer Hightech-Konzerne – Chinas Ausspähbemühungen erreichen inzwischen alle Sektoren. Behörden und Experten sehen darin nicht nur einen ökonomischen, sondern auch einen sicherheitspolitischen Angriff.
Ein Blick in die Zahlen
Als John C. Demers, damals Assistant Attorney General im US-Justizministerium, im Dezember 2018 vor dem Senat aussagte, legte er eindrückliche Zahlen auf den Tisch: In über 90 Prozent aller Fälle von Wirtschaftsspionage zwischen 2011 und 2018 seien chinesische Akteure involviert gewesen. Selbst bei allgemeinerem Diebstahl geistigen Eigentums führte in zwei von drei Fällen eine Spur nach China. Für Washington ist klar: Spionage aus Peking ist nicht mehr nur ein Ärgernis für Unternehmen, sondern eine Bedrohung für nationale Sicherheit.
Der Masterplan „Made in China 2025“
Die Stoßrichtung ist eindeutig. Mit der Industrie- und Technologieoffensive „Made in China 2025“ will Peking bis zum kommenden Jahrzehnt in zehn Schlüsselbranchen die globale Führungsrolle übernehmen – von Robotik über Medizintechnik bis zur Raumfahrt. Wo China Rückstände hat, sollen Spione nachhelfen. Auch die Bundesregierung in Berlin sieht deutsche Weltmarktführer gezielt im Fokus chinesischer Cyberaktivitäten. Analysten des Mercator Institute for China Studies (MERICS) bestätigen: Spionage dient als illegitimer Hebel, um Rückstände schnell zu schließen.
FBI: „All-Tools-and-All-Sectors-Approach“
Noch drastischer formulierte es FBI-Direktor Christopher Wray 2020: Peking fahre einen „All-Tools-and-All-Sectors-Approach“. Gemeint ist: Praktisch kein Wirtschaftszweig sei mehr sicher, Spionage richte sich längst nicht mehr nur auf Hightech. Sogar Forschung zu COVID-19 geriet ins Visier, wie eine Warnung von FBI und der US-Behörde CISA im Mai 2020 zeigte.
Steuerung durch die KPCh
Die Besonderheit: In China verschwimmen die Grenzen zwischen Staat und Wirtschaft. Unternehmen, selbst private, sind verpflichtet, Parteistrukturen einzurichten und Geheimdiensten bei Bedarf zu helfen. Seit 2017 schreibt das Nationale Geheimdienstgesetz vor, dass Einzelpersonen, Firmen und Organisationen im In- und Ausland mit den Diensten kooperieren müssen. Damit steht im Zweifel jedes Unternehmen mit China-Bezug im Dienst der KPCh.
Grauzonen und Fallbeispiele
Die Folge ist eine enge Fusion von staatlicher Wirtschaftsspionage und privater Konkurrenzspionage. Hackergruppen, Gastwissenschaftler oder ganze Firmen agieren im Auftrag – oder parallel – zu klassischen Geheimdiensten. Ein prominentes Beispiel: Beim Kölner Chemiekonzern Lanxess entwendeten Mitarbeiter über Jahre Know-how zu einer patentierten Substanz und gründeten ein Konkurrenzunternehmen in China. Der Nachweis staatlicher Verstrickung blieb aus – das Muster ist jedoch typisch.
Wissenschaft im Visier
Auch Universitäten sind längst Zielscheibe. Über Programme wie den „Tausend-Talente-Plan“ lockt China seit 2008 Forscher mit üppigen Mitteln ins Land – nicht selten verbunden mit der Erwartung, ihr Wissen in den Dienst der Volksrepublik zu stellen. Analysen des Australian Strategic Policy Institute zeigen, wie oft Verbindungen von Gastwissenschaftlern zur Volksbefreiungsarmee übersehen werden – teils würde eine einfache Online-Recherche Verdachtsmomente liefern.
Zivil-militärische Fusion
Besonders deutlich wird der Anspruch im Konzept der „zivil-militärischen Fusion“. Seit 2017 offiziell Staatsdoktrin, sollen zivile Forschung und militärische Entwicklung enger verzahnt werden. Präsident Xi Jinping nennt es eine Voraussetzung, um den „Chinesischen Traum“ von nationaler Stärke zu erfüllen. Westliche Technologien – ob legal erworben oder nicht – werden so direkt für das Militär nutzbar gemacht.
Wachsende Herausforderung
Für westliche Staaten und Unternehmen wächst damit der Druck. Während Geheimdienste warnen und Strafverfolger punktuell Erfolge erzielen, bleibt die Abwehr schwierig. Chinas Spionage ist kleinteilig, flexibel und global vernetzt. Wer sich schützen will, braucht daher nicht nur Firewalls, sondern auch ein Bewusstsein für die strategische Dimension: Wissen ist Macht – und China ist bereit, sich beides mit allen Mitteln zu sichern.
Zeitleiste: Chinas Spionage- und Technologieoffensiven (2008–2025)
- 2008 – Start des „Tausend-Talente-Plans“ (TTP). Ziel: chinesischstämmige Wissenschaftler im Ausland zurückholen und westliches Know-how nach China transferieren.
- 2010–2016 – Fall Lanxess (Deutschland): Mitarbeiter entwenden Chemie-Know-how und gründen Konkurrenzunternehmen in China.
- 2015 – Verabschiedung der Strategie „Made in China 2025“ (MIC25). Fokus auf zehn Schlüsselbranchen für globale Markt- und Technologieführerschaft.
- 2015 – Erstmalige Formulierung des Konzepts der „zivil-militärischen Fusion“ (militärische Nutzung ziviler Forschung).
- 2017 – Neues Nationales Geheimdienstgesetz (NGG). Verpflichtet Bürger, Unternehmen und Organisationen zur Zusammenarbeit mit chinesischen Diensten.
- 2017 – Gründung der „Zentralkommission für integrierte militärische und zivile Entwicklung“ zur Umsetzung der Fusion.
- 2018 – US-Justizministerium: 90 % aller Fälle von Wirtschaftsspionage zwischen 2011–2018 mit China-Bezug. Internationale Kritik am TTP nimmt zu; Peking beendet öffentliche Werbung, Programm läuft weiter.
- 2019 – Bundesregierung bestätigt: Deutsche Hochtechnologieunternehmen im Fokus chinesischer Spionage, orientiert an MIC25.
- Februar 2020 – FBI-Direktor Wray: China verfolgt einen „All-Tools-and-All-Sectors-Approach“ – kein Wirtschaftszweig mehr sicher.
- Mai 2020 – FBI und CISA warnen: Chinesische Akteure versuchen, COVID-19-Forschung auszuspähen.
- 2025 – Zielmarke von „Made in China 2025“: Globale Führungsrolle in zehn Schlüsselbranchen, gestützt durch zivil-militärische Fusion und weltweite Wissensabschöpfung.