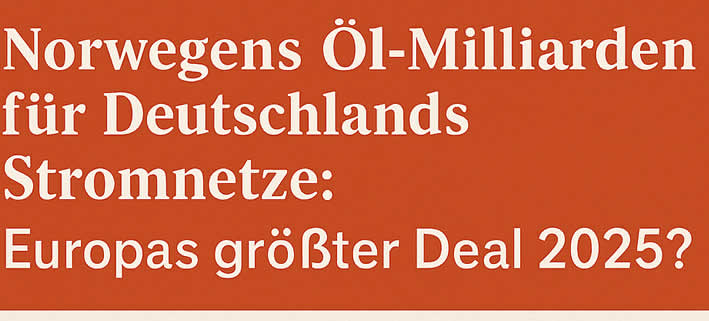Norwegens Öl-Milliarden für Deutschlands Stromnetze: Europas größter Deal 2025?
Wie der norwegische Staatsfonds sich in das Rückgrat der deutschen Energiewende einkaufen will – und was das über Europas neue Machtverhältnisse verrät
Bayreuth/Oslo – Es ist ein Geschäft, das Europas Energiearchitektur umformen könnte. Und es spielt sich erstaunlich leise ab. Während in Berlin über Wärmepumpen gestritten wird und Brüssel über CO₂-Grenzen diskutiert, verhandelt ein norwegischer Megafonds hinter den Kulissen über den Einstieg in eines der sensibelsten Netzwerke des Kontinents: das deutsche Hochspannungsnetz.
Hinter dem potenziell größten Infrastruktur-Deal Europas im Jahr 2025 steht niemand Geringeres als der weltgrößte Staatsfonds, verwaltet von Norges Bank Investment Management (NBIM). Der sogenannte <strong“>Government Pension Fund Global (GPFG) – gespeist aus Norwegens Öleinnahmen – prüft eine Milliardenbeteiligung an Tennet Germany, dem deutschen Ableger des niederländischen Netzbetreibers Tennet.
Was hier auf dem Spiel steht, ist nicht weniger als ein strategischer Umbau der Energieinfrastruktur Deutschlands – finanziert von einem Land, das selbst kaum auf fossile Energie angewiesen ist.
Von Lindner gestoppt, von Norwegen gerettet?
Tennet will raus. Der niederländische Mutterkonzern sucht seit Jahren nach Möglichkeiten, sich aus dem deutschen Stromgeschäft zurückzuziehen. Der erste Versuch, Anteile an die Bundesrepublik zu verkaufen, scheiterte – ausgerechnet an Finanzminister Christian Lindner. Die Staatskasse war zu klamm.
Jetzt kommt das Kapital von außen: Laut Handelsblatt-Informationen verhandelt NBIM in einem Konsortium mit dem niederländischen Pensionsfonds APG und dem singapurischen Staatsfonds GIC über eine Minderheitsbeteiligung an Tennet Germany. Eine Privatplatzierung oder ein Börsengang stehen zur Wahl. Die Entscheidung soll im September fallen.
Ein Einstieg mit Signalwirkung
Ein Einstieg des GPFG hätte weitreichende Implikationen:
-
- <l“>
Finanziell: Milliarden fließen in den schleppenden Netzausbau – ein kritischer Baustein der Energiewende.
- Politisch: Ausländische Investoren erhalten Zugang zu einem der zentralen Hebel der Energiepolitik.
- Systemisch: Der Trend zur Renationalisierung der Netze wird gebrochen – durch supranationales Kapital.
Dabei ist die Motivation des Fonds rein ökonomisch. Der GPFG sucht langfristige, stabile Renditen in Zeiten globaler Unsicherheit. Und das deutsche Stromnetz verspricht genau das – subventioniert, reguliert, systemrelevant.
320 Milliarden Gründe
Bis 2045 müssen laut Bundesnetzagentur rund 320 Milliarden Euro in den Netzausbau investiert werden, um die Stromströme aus Windparks im Norden in die Industrieregionen im Süden zu leiten. Ein erheblicher Teil dieser Leitungen wird als teures Erdkabel verlegt – eine politische Entscheidung, die ökologische Rücksicht und Akzeptanz in der Bevölkerung erkaufen soll.
Für Unternehmen wie Tennet ist das ein Kraftakt. Der Verkauf von Anteilen ist daher nicht nur ein Rückzug – sondern ein Kapitalbeschaffungsinstrument für ein Netz am Limit.
Staatsfonds statt Staat?
Was den Deal brisant macht: Er zeigt die neue Asymmetrie in Europas Energiepolitik. Während Staaten wie Deutschland den Rückzug aus privatwirtschaftlichen Modellen vollziehen wollen – „Netze in Bürgerhand“ ist das Motto –, übernehmen nun ausländische Staatsfonds die Rolle, die einst der nationale Staat spielte.
Die Ironie: Der Einstieg des norwegischen Ölfonds könnte die deutsche Energiewende retten – obwohl Norwegen selbst kaum Interesse am europäischen Strommarkt hat
Fazit: Europas Netzwerke werden globalisiert
Was auf den ersten Blick wie ein nüchterner Infrastrukturdeal wirkt, ist in Wahrheit ein geopolitisches Statement. Europa braucht Kapital, Norwegen hat es. Der Deal zwischen NBIM und Tennet Germany ist mehr als eine Investition – er ist ein Vertrauensvotum in Deutschlands Energiewende und ein Signal für die kommende Dekade:
Die Zukunft der europäischen Stromversorgung wird nicht nur in Brüssel entschieden – sondern auch in Oslo, Den Haag und Singapur.