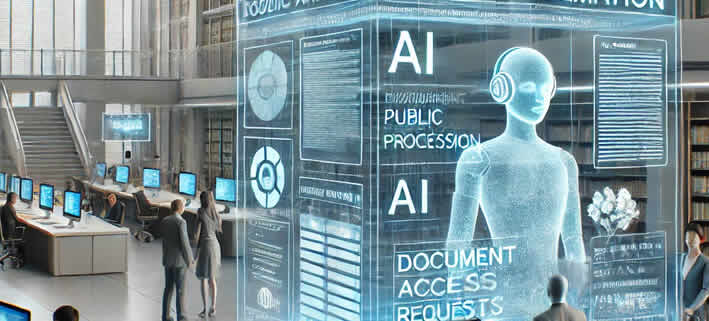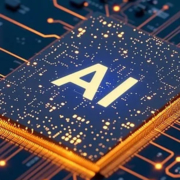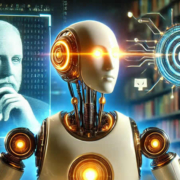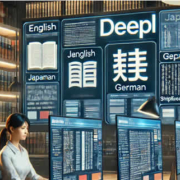Informationsfreiheitsgesetz digital neu denken: Wie KI Transparenz und Bürokratieabbau vereinen kann
Künstliche Intelligenz statt Rückschritt: Warum eine digitale Plattform die bessere Lösung für mehr Transparenz und weniger Bürokratie ist
Die Debatte um das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) hat durch den Vorstoß der Unionsparteien, das Gesetz in seiner bisherigen Form abzuschaffen, neue Brisanz erhalten. Die CDU und CSU begründen ihren Vorschlag mit dem Wunsch nach Bürokratieabbau und einer effizienteren Verwaltung. Kritiker hingegen warnen vor einem gefährlichen Rückschritt in Sachen demokratischer Kontrolle. Doch zwischen diesen beiden Polen – Effizienz und Transparenz – könnte es einen innovativen Mittelweg geben: Eine digitale Plattform, gestützt durch Künstliche Intelligenz (KI), die beides vereint.
Informationsfreiheit im digitalen Zeitalter
Seit 2006 ermöglicht das IFG Bürgerinnen und Bürgern sowie Journalisten den Zugang zu amtlichen Informationen. Es ist ein zentrales Werkzeug zur Kontrolle staatlichen Handelns. In einer modernen Demokratie stellt dieses Gesetz eine wichtige Brücke zwischen Verwaltung und Gesellschaft dar. Doch die zunehmende Zahl an Anträgen, steigende Komplexität und knappe Ressourcen in den Behörden führen zu wachsendem Druck – ein Umstand, den die Union zum Anlass für eine „Neujustierung“ nimmt.
Anstatt jedoch die Grundrechte auf Informationszugang einzuschränken, sollte der digitale Fortschritt genutzt werden, um den Zugang zu staatlicher Information effizienter zu gestalten.
Eine Plattform für Transparenz: So könnte sie funktionieren
Eine zentrale, digitale Plattform für Informationsfreiheit würde es ermöglichen, Anträge online zu stellen, Bearbeitungsstände einzusehen und Antworten automatisiert zu erhalten. Künstliche Intelligenz kann hierbei eine entscheidende Rolle spielen:
- Automatisierung von Standardanfragen: Viele Informationsanfragen betreffen wiederkehrende Themen wie Haushaltsdaten, Gutachten oder Umweltinformationen. Eine KI könnte solche Anfragen erkennen und passende, bereits veröffentlichte Dokumente vorschlagen oder direkt zugänglich machen.
- Reduktion der Bearbeitungszeit: Durch die automatische Klassifizierung und Vorprüfung von Anträgen kann der Verwaltungsaufwand erheblich gesenkt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden würden entlastet, ohne dass die Transparenz leidet.
- Proaktive Veröffentlichung: Die Plattform könnte standardisierte Daten regelmäßig und automatisch veröffentlichen – etwa zu Vergabeverfahren, Fördermitteln oder internen Leitlinien. Damit würde sich der Bedarf für Einzelanfragen erheblich verringern.
- Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit: Mit einem intuitiven Design, verständlicher Sprache und klaren Anleitungen könnte die Plattform auch Bürgerinnen und Bürgern ohne juristische oder verwaltungsrechtliche Vorkenntnisse den Zugang zu Informationen erleichtern.
Bürokratieabbau und Transparenz schließen sich nicht aus
Die Union verweist auf die Belastung der Verwaltung durch das IFG – ein nachvollziehbarer Punkt. Allerdings zeigt sich in anderen Ländern, dass Digitalisierung und Transparenz sehr wohl Hand in Hand gehen können. Großbritannien etwa verfolgt mit seiner „Open Government“-Strategie ein ambitioniertes Modell, das staatliche Daten aktiv bereitstellt und Bürgerbeteiligung fördert.
Statt Informationen hinter neuen Hürden zu verstecken oder auf einzelne Auskunftsrechte zurückzuschneiden, sollte die Bundesregierung den Schritt in die digitale Ära wagen und ein umfassendes Transparenzportal mit KI-Unterstützung aufbauen. Damit würde nicht nur dem Wunsch nach Bürokratieabbau entsprochen, sondern auch das Vertrauen in staatliches Handeln gestärkt.
Vertrauen durch Offenheit – auch in der Digitalisierung
Gerade in einer Zeit zunehmender Verunsicherung, politischer Polarisierung und wachsender Skepsis gegenüber staatlichen Institutionen ist Transparenz wichtiger denn je. Eine moderne Demokratie braucht klare, zugängliche Informationen – nicht weniger davon.
Die Grünen und der Deutsche Journalistenverband (DJV) warnen daher zurecht vor einer Abschaffung des IFG. Sie betonen, dass Transparenz nicht nur für Medien essenziell ist, sondern auch für Bürger, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Eine digitale Plattform könnte diese Forderung auf zeitgemäße Weise erfüllen – und dabei auch die Verwaltung entlasten.
Fazit: Digitalisierung als Chance, nicht als Vorwand
Die Diskussion um das IFG darf nicht rückwärtsgewandt geführt werden. Die technologische Entwicklung bietet heute Lösungen, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. Eine digitale Plattform mit KI-Komponenten ist keine Zukunftsvision, sondern längst realisierbar. Sie könnte als Vorbild für ein modernes Verständnis von Staatsbürgerlichkeit, Effizienz und Kontrolle dienen.
Der bessere Weg wäre also nicht die Abschaffung, sondern die digitale Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes – für eine Verwaltung, die zugleich bürgernah, effizient und transparent ist.