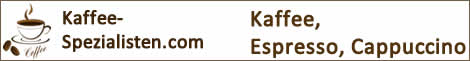Die USA kritisieren ein mögliches AfD-Verbot – warum Deutschland nicht nachgeben darf
Die Worte waren unmissverständlich. „Wenn Sie sich vor Ihren Bürgern fürchten, gibt es nichts, was Amerika für Sie tun kann“, sagte J.D. Vance, Amerikas neuer Vizepräsident, im Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Gemeint war Europa, speziell Deutschland. Die Kritik zielte auf den Umgang mit der AfD und die Diskussion über ein mögliches Parteiverbot.
Nun steht Bundeskanzler Friedrich Merz unter Druck: Einerseits fordern Teile seiner Koalition ein härteres Vorgehen gegen die AfD, bis hin zu einem Verbotsverfahren. Andererseits kommt aus Washington der warnende Zeigefinger – ein solcher Schritt sei ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Was tun?
Die Versuchung mag groß sein, den Amerikanern entgegenzukommen, um das transatlantische Verhältnis zu schonen. Doch ein Nachgeben wäre ein Fehler. Ein schwerer.
Meinungsfreiheit ist kein Exportartikel
Die amerikanische Kritik wirkt auf den ersten Blick als Verteidigung demokratischer Grundrechte. Tatsächlich ist sie Teil einer geopolitischen und innenpolitischen Strategie. In den USA ist die Redefreiheit nahezu absolut. Selbst extremistische Gruppen genießen Schutz, solange sie nicht direkt zu Gewalt aufrufen. In Europa – und besonders in Deutschland – gilt dagegen das Prinzip der „wehrhaften Demokratie“. Aus gutem Grund.
Deutschland hat aus seiner Geschichte gelernt, dass Feinde der Demokratie nicht erst dann bekämpft werden dürfen, wenn es zu spät ist. Die rechtlichen Möglichkeiten, verfassungsfeindliche Parteien zu verbieten, sind Ausdruck dieser Verantwortung. Die USA mögen das anders sehen. Aber das Grundgesetz schreibt keine außenpolitische Rücksichtnahme vor. Es bindet den Staat an die eigene Verfassung, nicht an die Ideale Washingtons.
Ein gefährlicher Präzedenzfall
Noch gefährlicher als die inhaltliche Kritik ist die Methode: Ein transatlantischer Partner versucht, mit öffentlichem Druck auf eine innere Angelegenheit Einfluss zu nehmen. Wer jetzt nachgibt, öffnet die Tür für künftige Einmischungen. Dann geht es vielleicht um Datenschutz, Digitalpolitik oder Sozialstandards. Die Lektion der Trump-Ära sollte sein: Wer sich auf den Unilateralismus Amerikas einlässt, verliert an Eigenständigkeit, ohne Verlässlichkeit zu gewinnen.
Deutschland darf sich nicht erpressbar machen – weder mit moralischen Vorhaltungen noch mit angedeuteten sicherheitspolitischen Konsequenzen.
Souveränität ist der eigentliche Prüfstein
Es geht hier nicht primär um die AfD. Es geht um die Frage, ob Deutschland seinen verfassungsrechtlich vorgesehenen Weg geht – mit höchstrichterlicher Prüfung, rechtsstaatlicher Transparenz und parlamentarischer Debatte. Oder ob es diesen Weg abbricht, weil ein außenpolitischer Partner Druck macht.
Die Diskussion über ein AfD-Verbot mag berechtigt oder falsch sein. Aber sie muss allein nach deutschem Recht entschieden werden – nicht unter dem Einfluss geopolitischer Interessen.
Die USA haben das Recht, ihre Meinung zu äußern. Aber sie haben kein Recht, Deutschlands demokratische Prozesse zu delegitimieren. Gerade jetzt muss Deutschland zeigen: Meinungsfreiheit bedeutet auch, sich nicht den Maßstäben anderer unterzuordnen.
Bundeskanzler Merz hat immer betont, Transatlantiker zu sein. Er sollte diesen Kurs beibehalten – aber als gleichberechtigter Partner, nicht als Bittsteller. Wer Souveränität aufgibt, verliert am Ende auch den Respekt derjenigen, denen er gefallen will.