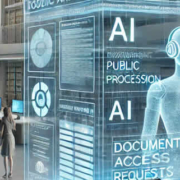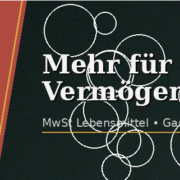Demokratische Mitte unter Druck: Was SPD und US-Demokraten von Trumps Aufstieg lernen müssen
Zwischen Absturz und Aufbruch: Warum SPD und US-Demokraten dieselben Fehler machen – und die AfD Trumps Strategie kopiert
Analyse politischer Parallelen zwischen Deutschland und den USA: Der Aufstieg rechter Bewegungen und die Schwäche der linken Mitte
In den Vereinigten Staaten geht Donald Trump gestärkt aus der jüngsten Präsidentschaftswahl hervor. Währenddessen wirkt die US-Demokratische Partei wie gelähmt, zerrissen zwischen strategischer Unentschlossenheit und wachsender interner Kritik. In Deutschland zeigen sich ähnliche Muster: Die SPD verliert an Rückhalt, insbesondere in der Arbeiterschaft, während die AfD bundesweit und besonders im Osten auf dem Vormarsch ist. Zwei Demokratien, zwei Parteien – aber ein gemeinsames Problem: die Entfremdung von der eigenen Basis.
SPD und US-Demokraten: Der Verlust der Arbeiterschicht
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands – einst politische Heimat der industriellen Arbeiterschaft – erlebt eine tiefgreifende Krise. In Umfragen fällt sie teils unter die 15-Prozent-Marke. Besonders beunruhigend: Der Rückhalt in der klassischen Stammwählerschaft schwindet. Genau das erlebten die US-Demokraten bereits vor Jahren. In beiden Fällen haben viele Wählerinnen und Wähler das Gefühl, dass sich die Partei vom alltäglichen Leben der Menschen entfernt hat.
Während sich weite Teile der Bevölkerung mit steigenden Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot und prekären Arbeitsverhältnissen konfrontiert sehen, setzen SPD wie Demokraten auf technokratische Lösungen, zaghafte Reformen oder Koalitionskompromisse. Die Sprache der sozialen Gerechtigkeit, einst Kern ihrer Identität, ist vielerorts einem politischen Pragmatismus gewichen, der kaum noch mobilisiert.
Lies auch:
US-Demokraten in der Krise: Linker Populismus als Antwort auf Trump?
Rechtspopulismus im Aufwind: Trumps Erbe und das deutsche Echo
Die AfD in Deutschland gewinnt dort, wo die SPD verliert – nicht nur geografisch, sondern auch politisch. Sie präsentiert sich, ähnlich wie Donald Trump in den USA, als Partei der „Vergessenen“, der „normalen Bürger“, die von der etablierten Politik übergangen würden. Populistische Narrative wie „Wir gegen das Establishment“ oder „Das Volk gegen die Eliten“ ziehen.
Trump hat vorgemacht, wie man mit provokativen Botschaften, Identitätspolitik von rechts und der Umdeutung sozialer Ängste in nationalistische Wut Wahlen gewinnen kann. Die AfD adaptiert diese Strategie für den deutschen Kontext – mit einem Fokus auf Migration, Medienkritik und Staatsverachtung. Viele Parolen erinnern an Trumps Sprachgebrauch, sein Misstrauen gegenüber Institutionen, Wissenschaft und Presse findet in der AfD eine deutsche Entsprechung.
Project 2025 und autoritäre Umbaupläne – auch in Deutschland?
In den USA steht mit „Project 2025“ ein konservatives Umbauprojekt bereit, das unter Trump umgesetzt werden soll. Ziel ist es, den Staatsapparat politisch zu unterwandern, zentrale Kontrollinstanzen zu entmachten und loyale Gefolgsleute an entscheidende Stellen zu setzen. Auch soziale Programme stehen auf der Abschussliste – mit massiven Konsequenzen für Millionen Bürgerinnen und Bürger.
In Deutschland existiert kein derart formalisierter Masterplan – doch der autoritäre Gestus zeigt sich auch hier. Die AfD fordert etwa die Zerschlagung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, stellt das Bundesverfassungsgericht infrage und ruft immer wieder zu einer „Wende“ in der politischen Kultur auf. Solche Vorschläge zielen darauf, demokratische Institutionen zu schwächen – ein Ziel, das den Grundgedanken von Project 2025 durchaus ähnelt.
Zögerliche Antworten der Mitte
Sowohl in den USA als auch in Deutschland reagieren die Mitte-Parteien schwach. Anstatt klare politische Gegenentwürfe zu präsentieren, setzen sie auf Konsens und Moderation. Doch in Zeiten populistischer Zuspitzung reicht das nicht. Die Realität: Wählerinnen und Wähler, die sich im Stich gelassen fühlen, suchen nach radikaleren Alternativen.
Die Linke – in Deutschland ebenso wie in den USA – ist in der Lage, diesen Raum zu füllen. Doch sie muss es auch wollen. Persönlichkeiten wie Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez zeigen, wie man soziale Politik glaubwürdig und mobilisierend formulieren kann. In Deutschland fehlt bislang ein vergleichbarer Aufbruch. Die SPD ringt mit sich selbst, und das neue Projekt „Bündnis Sahra Wagenknecht“ droht, die Linke weiter zu schwächen, statt sie zu erneuern.
Die Lehren: Mehr Haltung, weniger Taktik
Die Krise der Mitte ist eine Krise der Repräsentation. Menschen erwarten nicht nur Kompetenz, sondern auch Haltung. Wer soziale Gerechtigkeit glaubhaft vertreten will, muss bereit sein, Konflikte auszutragen – auch mit mächtigen wirtschaftlichen Interessen. Der Versuch, es allen recht zu machen, endet oft damit, dass man niemanden mehr überzeugt.
In beiden Ländern wäre ein linker Populismus denkbar – einer, der nicht auf Feindbilder, sondern auf Gerechtigkeit setzt. Der nicht den Migranten als Sündenbock markiert, sondern den Konzern, der keine Steuern zahlt. Der nicht die Klimapolitik verteufelt, sondern dafür sorgt, dass sie sozial verträglich wird. Ob SPD und Demokraten diesen Weg gehen, ist unklar. Die Notwendigkeit dazu aber wächst täglich.