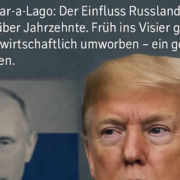Die Staatsfonds-Illusion – Was Trump von Norwegen nicht lernen kann
Washington träumt – von fiskaler Stabilität, globalem Einfluss und einem Geldregen für kommende Generationen. Möglich machen soll das ein Staatsfonds nach norwegischem Vorbild. Doch ausgerechnet der Mann, der den größten Fonds der Welt verwaltet, bremst die Euphorie. Für Nicolai Tangen ist klar: Was in Oslo funktioniert, wird in Washington kaum aufgehen.
Milliarden sind nicht genug
Wenn Nicolai Tangen über Geld spricht, geht es nicht um Peanuts. Er verwaltet den norwegischen Staatsfonds – einen Koloss mit mehr als 1,7 Billionen Dollar Anlagevermögen. Der Fonds hält Anteile an über 9.000 Unternehmen weltweit, darunter Apple, Microsoft und Nestlé. Doch Tangen bleibt nüchtern: „Es braucht weit mehr als Kapital, um einen erfolgreichen Fonds aufzubauen“, sagte er am Montag in einem Interview mit Yahoo Finance.
Diese Warnung kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Donald Trump hat Anfang Februar per Dekret das Finanz- und Handelsministerium beauftragt, einen Plan für einen US-Staatsfonds auszuarbeiten. Schlagworte wie „fiskalische Nachhaltigkeit“, „strategische Führungsrolle“ und „gigantische Gewinne“ dominieren das Papier. Die Realität ist komplexer.
Ein Modell, das nicht exportiert werden kann
Tangen nennt drei Faktoren für Norwegens Erfolg: politische Kontinuität, Transparenz und eine langfristige Perspektive. Was in der Theorie nach amerikanischem Traum klingt, ist in der Praxis kaum übertragbar. In Norwegen herrscht parteiübergreifende Einigkeit über den Fonds. Regierungen kommen und gehen – die Anlagestrategie bleibt. In den USA hingegen wechseln mit jeder Administration nicht nur Köpfe, sondern ganze Weltanschauungen.
Hinzu kommt eine eiserne Regel: Maximal drei Prozent der erwarteten realen Rendite dürfen jährlich aus dem Fonds entnommen werden. Der Rest wird wieder angelegt – und gesichert für kommende Generationen. In einem Land wie den USA, das regelmäßig mit Haushaltssperren, Schuldenobergrenzen und kurzfristigen Wahlzyklen kämpft, klingt das wie Finanzmystik.
Wunschdenken trifft Haushaltsdefizit
Woher das Startkapital für einen US-Fonds kommen soll, bleibt nebulös. Das Weiße Haus verweist auf Bundesvermögen in Höhe von 5,7 Billionen Dollar – darunter Land, Gebäude und Beteiligungen. Doch die Monetarisierung dieses Portfolios wäre nicht nur politisch heikel, sondern auch wirtschaftlich fragwürdig. Ein Ausverkauf von Bundesland? Privatisierung öffentlicher Infrastruktur? Schon der Gedanke daran ist ein Pulverfass im Wahljahr.
Im Gegensatz zu Norwegen fehlt den USA zudem eine natürliche Einnahmequelle wie Erdöl. Der norwegische Fonds speist sich seit Jahrzehnten aus den Gewinnen der Öl- und Gasexporte. Die USA hingegen schreiben seit Jahren ein strukturelles Haushaltsdefizit – trotz florierender Aktienmärkte.
Alaska ist nicht Amerika
Befürworter verweisen gerne auf den Alaska Permanent Fund – ein kleiner Staatsfonds auf Bundesstaatenebene, gespeist aus lokalen Rohstoffeinnahmen. Jährlich zahlt er Dividenden an die Einwohner. Doch der Versuch, dieses Modell auf 50 Bundesstaaten und eine föderale Regierung zu übertragen, wäre wie der Versuch, ein Kanu in einen Flugzeugträger zu verwandeln.
Auch Trumps Versprechen, mit einem Staatsfonds die Staatsschulden zu senken, wirkt ökonomisch naiv. Ein Fonds lebt davon, nicht ausgeschlachtet zu werden. Jede Entnahme – vor allem zur kurzfristigen Schuldenreduktion – wäre ein Rückfall in alte Muster. Für einen echten Staatsfonds braucht es genau das Gegenteil: Disziplin, Geduld, Generationendenken.
Ein Mann, eine Mahnung
Tangen selbst wirkt unaufgeregt. „Ich denke nicht, dass ein einzelner Fonds den US-Aktienmarkt signifikant beeinflussen würde“, sagt er. Die eigentliche Botschaft aber liegt tiefer: Wer einen Staatsfonds errichten will, muss bereit sein, sich selbst zurückzunehmen. Kein Präsident, kein Kongress und keine Tagespolitik darf sich einmischen. Genau hier liegt das Problem.
Die USA sind eine Supermacht, aber keine Stiftung. Sie agieren im Rhythmus von Wahlzyklen, Medienhypes und Lobbyinteressen. Norwegen ist das Gegenteil: klein, konsensorientiert, vermögend – mit einem Staatsfonds, der mehr Geduld als Pathos kennt.
Vielleicht ist es genau das, was Nicolai Tangen meinte, als er sagte:
„Es ist weit mehr als Ehrgeiz oder Kapital – es ist eine Frage der Kultur.“