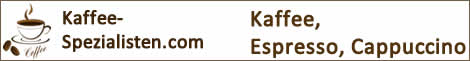Das deutsche Exportmodell ist nicht tot, aber umzubauen
Kommentar & Analyse
Über Jahrzehnte war es einfach: Deutsche Unternehmen bauten Präzisionsmaschinen, Premiumautos, Spezialchemie – und die Welt kaufte. Dieses Modell wankt, aber es ist nicht passé. Es braucht eine radikale Überholung: mehr Investitionen in Produktivität, tiefere Wertschöpfung bei Schlüsseltechnologien, schnellere Politik. Andernfalls bleibt vom Exportruhm vor allem ein Mythos.
Die Diagnose: Stagnation mit Ansage
Die Wirtschaft tritt real auf der Stelle, der Kapitalstock altert. In vielen Betrieben wird länger gewartet, statt erneuert – bei Anlagen, Software, Energieeffizienz. Das rächt sich doppelt: Die Kostenbasis bleibt hoch, die Innovationsgeschwindigkeit niedrig. Gleichzeitig rückt das Umfeld dichter: Die USA ziehen mit massiven Subventionen private Milliarden an, China skaliert ganze Industrien von Batterien bis Elektronik. Wer zögert, verliert.
Was am alten Modell nicht mehr trägt
- Reine Premium-Logik: Nur „teurer, besser“ reicht nicht mehr. Software, Services und Betriebskosten entscheiden, nicht nur Stahl und Spaltmaß.
- Komplexe Lieferketten: Abhängigkeiten bei Vorstufen (z. B. Kathodenmaterial, Leistungshalbleiter) machen verwundbar – politisch wie preislich.
- Niedrige Taktung: Modellzyklen über sechs Jahre und jährliche Produkt-Updates passen nicht in Märkte, die quartalsweise Over-the-Air liefern.
Die Stärken bleiben – wenn sie genutzt werden
Deutschland verfügt über Weltklasse in Maschinenbau, Werkstoffen, Verfahrenstechnik und industrieller IT. Genau daraus lässt sich ein erneuertes Exportmodell bauen: weniger Endmontage, mehr Kerntechnologie; weniger Einzelprodukt, mehr Plattform; weniger Ankündigung, mehr Umsetzung.
Branchen mit größtem Hebel
- Auto: Batterievorstufen & Inverter lokalisieren, Softwareerlöse aufbauen, Assistenz/NOA mit klaren Sicherheitskriterien ausrollen.
- Maschinenbau: „Equipment-as-a-Service“, Fernwartung, digitale Zwillinge – Anlagen plus Betriebsmodell exportieren.
- Chemie/Werkstoffe: grüne Vorprodukte als Premium-Input, je transparenter das CO₂-Profil, desto weniger preissensibel.
- Energie/Netze: Speicher, Netzkomponenten, Leistungselektronik – Grundausstattung für Dekarbonisierung.
Woran der Fortschritt messbar ist
- Investitionen: deutlich über Vorkrisenniveau, höherer Digital- und Effizienzanteil.
- Lokale Vorstufen: wachsender EU-Anteil bei Batterie- und Power-Elektronik-Materialien.
- Software-Takt: ≥ 4 OTA-Releases/Jahr je Produktlinie; steigende wiederkehrende Umsätze.
- Genehmigungen: halbierte Zeiten für Industrie- und Netzausbauprojekte.
- Exporte: mehr Umsatz außerhalb der beiden Hauptmärkte, geringere Klumpenrisiken.
Umbauplan: Fünf Schritte bis 2030
1) Richtig investieren – Produktivität zuerst
- Wohin? Automatisierung, sparsame Prozesse, gemeinsame Datenplattformen, KI in der Qualität.
- Wie finanzieren? Schnellere Abschreibungen, gezielte Co-Investments für Batterien, Leistungselektronik und Recycling.
- Zielbild: Investitionen klar über Vorkrisenniveau; Anlagen spürbar besser ausgelastet.
2) Mehr Tiefe – vom Modul zur Materie
- Batterien & Materialien: eigene Kathoden/Anoden und Beschichtungen aufbauen – nicht nur Zellen einkaufen.
- Power-Elektronik: SiC-Bauteile, Inverter, Ladegeräte in Europa fertigen.
- Recycling: hohe Rückgewinnung als „zweites Rohstoffwerk“ skalieren.
3) Software ernst nehmen – Updates im Quartal
- Plattform statt Einzelprodukt: offene Schnittstellen, App-Ökosystem, nutzungsbasierte Angebote.
- OTA als Standard: mind. vier relevante Updates pro Jahr, mit Nutzungs- und Sicherheitsnachweisen.
- Gemeinsame Datenräume: einheitliche Standards zwischen OEM, Zulieferern und Kunden.
4) Export neu ordnen – breiter und robuster
- Märkte erweitern: gezielt Südostasien, Indien, MENA, Lateinamerika – mit Service vor Ort.
- Risiken absichern: Verträge gegen Zollschocks, Dual-Sourcing/Nearshoring, politisches Frühwarnsystem.
- Europa lieferfähig machen: Netze und Logistik ausbauen, damit hier skaliert werden kann.
5) Tempo organisieren – vom Plan zur Genehmigung
- Permitting: feste Fristen, digital, Standardfälle nach dem Prinzip „Schweigen = Zustimmung“.
- Beschaffung: nicht nur Preis – auch Resilienz, CO₂-Bilanz und IT-Sicherheit werten.
- Fachkräfte: Weiterbildung, schnelle Anerkennung, gesteuerte Zuwanderung in Mangelberufe.
Fazit
Das deutsche Exportmodell ist nicht am Ende – es ist untermodernisiert. Wer jetzt in Produktivität, Vorstufen und Software investiert, kann die nächste Runde gewinnen. Der Rest wird von der Geschichte überholt. Es geht nicht um Nostalgie, sondern um Taktung, Tiefe und Tempo. Der Umbau ist machbar. Aber er duldet keinen Aufschub.