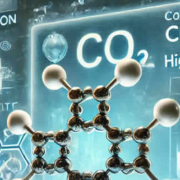Ein Motor, der mit der Kälte des Himmels läuft
Wie Forschende nachts Energie gewinnen – ganz ohne Sonne und Brennstoff
Normalerweise denken wir bei Energie aus Strahlung an die Sonne und Solaranlagen. Doch auch die Erde selbst strahlt Energie ab – vor allem nachts, wenn es dunkel ist. Ein Team der University of California in Davis hat gezeigt, dass man diese nächtliche Wärmestrahlung nutzen kann, um einen Motor anzutreiben, der:
- ganz ohne Brennstoff läuft,
- ohne Batterie auskommt und
- speziell nachts funktioniert, wenn Solarpanels nichts liefern.
Kernstück des Ganzen ist ein Stirlingmotor, der den Temperaturunterschied zwischen der warmen Erde und dem kalten Himmel ausnutzt.
Was ist radiative Kühlung?
Jeder warme Körper sendet Wärmestrahlung aus – auch die Erde, Hausdächer oder Metallplatten. Die Atmosphäre besitzt dabei ein besonderes „Fenster“:
- In einem bestimmten Bereich der Infrarotstrahlung (ca. 8–13 µm) ist die Luft relativ durchsichtig.
- Durch dieses „Infrarot-Fenster“ kann Wärme direkt ins Weltall abgestrahlt werden.
- Eine Fläche mit freiem Blick zum Himmel kann sich so unter die Umgebungstemperatur abkühlen.
Dieses Prinzip nennt man radiative cooling (Strahlungskühlung). Genau diesen Effekt nutzt der Motor:
- unten: Wärme von der Erde,
- oben: Kälte durch Wärmestrahlung in den Himmel.
Dazwischen sitzt die Maschine, die den Temperaturunterschied in Bewegung umwandelt.
Der Stirlingmotor – einfach erklärt
Ein Stirlingmotor ist eine Wärmekraftmaschine, die nicht mit Explosionen wie ein Auto-Motor arbeitet, sondern nur mit einer warmen und einer kalten Seite.
Ganz vereinfacht funktioniert er so:
- In einem geschlossenen Raum befindet sich ein Gas (z. B. Luft).
- Wird das Gas erwärmt, dehnt es sich aus und drückt einen Kolben.
- Wird es abgekühlt, zieht es sich zusammen, der Kolben bewegt sich zurück.
- Ein Schwungrad macht aus dieser Hin-und-her-Bewegung eine Drehbewegung.
Wichtig ist: Ein Stirlingmotor kann schon mit kleinen Temperaturunterschieden arbeiten – etwa 10 Grad Celsius reichen aus. Genau diese Temperaturdifferenz liefert die radiative Kühlung.
So sieht der Aufbau aus
Für den Versuch wurde ein fertiger Niedertemperatur-Stirlingmotor umgebaut:
- Untere Platte:
Eine Metallplatte steht in gutem Wärmekontakt mit dem Boden. Sie nimmt die Wärme der Erde auf
und bildet die „warme Seite“ des Motors. - Obere Platte:
Eine größere Metallplatte zeigt in den Himmel und ist mit einer speziellen
Infrarot-Farbe beschichtet. Sie strahlt Wärme in den Weltraum ab und kühlt deutlich ab –
das ist die „kalte Seite“.
Zwischen diesen beiden Platten sitzt der Stirlingmotor. Wenn nach Sonnenuntergang der Himmel klar ist, ergibt sich:
- ein Temperaturunterschied von oft mehr als 10 °C,
- der Motor läuft von selbst an und
- dreht sich mit etwa einer Umdrehung pro Sekunde.
Es wird kein Strom und kein Brennstoff benötigt – nur der natürliche Temperaturunterschied zwischen Erde und Himmel.
Was haben die Messungen gezeigt?
Die Forschenden haben den Motor ein ganzes Jahr lang draußen getestet – auf einer freien Fläche bei Davis in Kalifornien:
- In den meisten Nächten war der Temperaturunterschied groß genug, damit der Motor läuft.
- Bei klaren, trockenen Sommernächten funktioniert das System am besten.
- Bei bewölktem, feuchtem Winterwetter sinkt die Leistung, weil Wasserdampf Teile der Wärmestrahlung blockiert.
Zur Leistung des Motors:
- Er erzeugt über 400 Milliwatt mechanische Leistung pro Quadratmeter der Himmelsplatte.
- Mit verbesserten Materialien und Aufbau sind laut Berechnungen mehr als 6 Watt pro Quadratmeter möglich.
Diese Werte reichen nicht, um ein Haus mit Strom zu versorgen, aber sie sind ideal für Aufgaben, bei denen man direkt mechanische Energie braucht – zum Beispiel
für die Belüftung.
Lüften ohne Strom: der Motor als Ventilator
Eine besonders praktische Anwendung ist die Luftbewegung in Gewächshäusern oder Gebäuden. Dafür wurde das Schwungrad durch einen Ventilatorflügel ersetzt und typische Bedingungen nachgestellt, zum Beispiel:
- wärmerer Innenraum (z. B. Gewächshaus) mit etwa 29 °C,
- radiativ gekühlte Platte mit etwa 7 °C.
Die Messungen ergaben:
- eine Luftgeschwindigkeit von etwa 0,3 m/s direkt vor dem Ventilator,
- das reicht aus, um CO₂ in Gewächshäusern gut zu verteilen und das Pflanzenwachstum zu fördern.
Bei kleineren Temperaturunterschieden von ca. 10 °C schafft der Motor:
- 0,15–0,2 m/s Luftgeschwindigkeit,
- genau der Bereich, der als angenehm für den thermischen Komfort in Innenräumen gilt.
Bei noch größeren Temperaturdifferenzen (über 30 °C) nähert sich der Luftstrom der Mindestmenge an Frischluft, die pro Person in öffentlichen Gebäuden empfohlen wird.
Kurz gesagt: Der Motor kann Gewächshäuser und Räume nachts passiv belüften, ohne einen Anschluss ans Stromnetz zu benötigen.
Mechanische Energie und ein bisschen Strom
Zusätzlich haben die Forschenden einen kleinen Gleichstrommotor (wie einen Dynamo)
an die Achse des Stirlingmotors gekoppelt:
- Ein Teil der Drehbewegung wird in elektrische Energie umgewandelt.
- Die elektrische Leistung ist noch klein, da der Generator nicht optimiert ist,
- aber sie könnte für Sensoren, einfache Elektronik oder kleine Batterien ausreichen.
Wichtig ist: Auch mit Generator bleibt noch genügend mechanische Leistung übrig, um z. B. den Ventilator anzutreiben. Das System kann also gleichzeitig Luft bewegen
und ein wenig Strom liefern.
Wo funktioniert das besonders gut?
Mit Hilfe von Satellitendaten wurde berechnet, wo diese Technik auf der Welt besonders gut funktioniert.
Am besten ist sie geeignet in:
- trockenen Wüstenregionen (z. B. Sahara),
- Hochgebirgen,
- Teilen der Eurasischen Steppe und
- in der Sommer-Antarktis.
Dort ist die Luft sehr trocken und der Himmel oft klar – perfekte Bedingungen für starke radiative Kühlung.
Schwieriger ist der Einsatz in:
- feuchten, tropischen und stark bewaldeten Regionen,
- denn dort enthält die Luft viel Wasserdampf, der Teile der Wärmestrahlung blockiert.
Hilft das auch beim Klimaschutz?
Die Erde nimmt derzeit etwas mehr Energie auf, als sie abgibt – das führt zur globalen Erwärmung.
Radiative Kühler können helfen, die Abstrahlung in den Weltraum zu erhöhen
und so einen kleinen Beitrag zur Entlastung des Klimasystems leisten.
Der Stirlingmotor nutzt genau diesen Effekt:
- Er verstärkt die Wärmeabgabe der Erde durch das Infrarotfenster.
- Er „fängt“ einen Teil dieser Energie ab und wandelt sie in nützliche Arbeit um.
Allein wird diese Technik das Klima nicht retten. Aber sie kann eine zusätzliche, saubere Energiequelle in der Nacht sein,
die gleichzeitig hilft, Wärme loszuwerden.
Wie könnte man das noch verbessern?
Die aktuelle Version ist ein Prototyp, doch es gibt viele Ideen zur Optimierung:
- bessere Radiator-Materialien statt normaler Farbe,
- Isolierung und eventuell Vakuumgehäuse, damit die kalte Platte noch kälter wird,
- Nutzung von Abwärme (z. B. aus Industrie oder Gebäuden) als „heiße Seite“,
- größerer und besser abgestimmter Stirlingmotor,
- andere Gase im Motor (z. B. Helium), um Reibung und Verluste zu reduzieren.
Langfristig könnten solche Motoren sogar tagsüber und nachts laufen und Solarenergie am Tag sowie radiative Kühlung in der Nacht sinnvoll ergänzen.
Fazit
Der radiativ gekühlte Stirlingmotor zeigt eindrucksvoll:
- Mit der Kälte des Himmels und der Wärme der Erde
lässt sich eine reale Maschine betreiben. - Sie liefert mechanische Energie (z. B. für Ventilatoren)
- und auf Wunsch auch ein wenig elektrischen Strom.
Er ersetzt keine großen Kraftwerke, aber er ist eine clevere, einfache Technik für Orte, an denen man robuste, wartungsarme und stromlose
Lüftung oder kleine Antriebe braucht – besonders in der Nacht.
Weiterführende Informationen