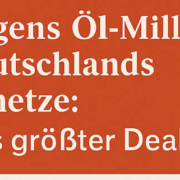Energiewende von unten: Warum dezentrale Stromlösungen die besseren Antworten liefern
Berlin – Deutschlands Energiewende steckt im Dilemma: Der Strombedarf steigt rasant, die Politik schwankt zwischen ambitionierten Klimazielen und der Angst vor Versorgungsengpässen. Während Energiekonzerne neue Gaskraftwerke fordern, setzt eine aktuelle Studie von Roland Berger im Auftrag von Enpal auf eine andere Richtung: Dezentrale Stromlösungen – Solaranlagen, Batteriespeicher, Wärmepumpen und E-Autos – könnten sich als entscheidender Hebel erweisen.
Milliarden-Ersparnis statt Kostenexplosion
Bis 2035 könnte der Strombedarf um bis zu 90 Prozent steigen. Ohne Gegenmaßnahmen drohen gewaltige Investitionen in Netzausbau und konventionelle Backup-Kapazitäten. Dezentrale Systeme versprechen hier eine Entlastung: Sie senken nicht nur den Bedarf an neuen Großkraftwerken, sondern auch die Kosten für Netzinstandhaltung. Laut Studie lassen sich bis 2045 40 bis 60 Milliarden Euro einsparen – genug, um den Umbau der Energiewirtschaft erheblich zu beschleunigen.
Innovationstreiber für den Standort
Anders als in den Diskussionen um Subventionen für Gaskraftwerke liegt in den dezentralen Lösungen ein enormes Innovationspotenzial. Deutschland könnte zum Exporteur von Energiemanagementsystemen und Smart-Grid-Technologien werden, ähnlich wie es die Autoindustrie einst mit Verbrennungsmotoren war. Bis zu 100.000 neue Jobs seien möglich, heißt es. Besonders junge Unternehmen im „Energy Tech“-Bereich könnten dabei zu einem Wachstumsmotor werden.
Die neue Macht der Verbraucher
Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Nutzen greifbar: Haushalte sparen im Schnitt 900 bis 1.200 Euro Stromkosten pro Jahr, kleine Unternehmen 1.500 bis 2.500 Euro. Doch die Studie betont: Es geht um mehr als nur Geld. Aus passiven Verbrauchern werden „Flexumer“ – Akteure, die Strom nicht nur nutzen, sondern auch erzeugen, speichern und gezielt einspeisen. Wer eine Photovoltaikanlage, ein Batteriesystem und vielleicht ein Elektroauto besitzt, kann flexibel auf Preissignale reagieren und trägt damit zur Stabilität des Stromnetzes bei.
Weniger Abhängigkeit, mehr Resilienz
Auch geopolitisch ist das Argument stark: Jedes Kilowatt, das lokal produziert und genutzt wird, reduziert die Abhängigkeit von fossilen Importen. Angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahre mit schwankenden Gaspreisen und globalen Krisen ist die Stärkung lokaler Resilienz mehr als ein ökologisches Ideal – sie wird zur ökonomischen Notwendigkeit.
Ein politisches Versäumnis
Dennoch bleiben dezentrale Lösungen in Berlin ein Randthema. Die Debatte kreist weiter um Gaskraftwerke und zentrale Großstrukturen. Die Studie hält dagegen: Nur durch ein Zusammenspiel von Erneuerbaren, Dezentralen und – als Übergang – konventionellen Kapazitäten lässt sich die Energiewende kosteneffizient und sicher gestalten.
Fazit
Die eigentliche Botschaft lautet: Die Energiewende entscheidet sich nicht allein in Großkraftwerken oder auf internationalen Märkten, sondern auf den Dächern, in Kellern und Garagen der Bürgerinnen und Bürger. Dezentrale Stromlösungen sind kein Beiwerk, sondern könnten sich als Fundament eines klimaneutralen und bezahlbaren Energiesystems erweisen.