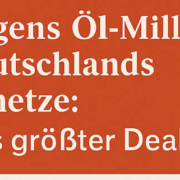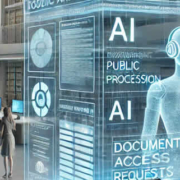Batteriespeicher: Deutschlands schwaches Glied der Energiewende
Australien baut riesige Großspeicher – Deutschland setzt noch immer vor allem auf kleine Heimspeicher. Ohne einen massiven Ausbau drohen die Klimaziele zu scheitern.
Australien macht es vor
Mit der Waratah Super Battery ging am 5. August 2025 in Australien einer der größten Batteriespeicher der Welt teilweise ans Netz. In der ersten Ausbaustufe stehen bereits 350 Megawatt (MW) Leistung und 700 Megawattstunden (MWh) Kapazität bereit. Bis Ende des Jahres soll die Anlage ihre volle Größe erreichen – mit 850 MW Leistung und 1680 MWh Speicherkapazität. Damit könnten rund 970.000 Haushalte eine halbe Stunde lang mit Energie versorgt werden.
Deutschland dagegen setzt bislang überwiegend auf kleine Heimspeicher. Sie helfen zwar Eigenheimbesitzern, Solarstrom besser zu nutzen, tragen aber kaum zur Stabilisierung des Gesamtnetzes bei.
Deutschland muss Speicherkapazität verzehnfachen
Laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme steigt der Bedarf an Batteriespeichern bis 2030 auf rund 100 Gigawattstunden (GWh), bis 2045 sogar auf 180 GWh. Der aktuelle Stand: gerade einmal 19 GWh – davon der Großteil in privaten Speichern. Großanlagen sind noch die Ausnahme.
„Der Ausbau hinkt in Deutschland deutlich hinterher“, warnt der Energieexperte Tim Meyer. „Wir brauchen eine Verzehnfachung der Kapazitäten, sonst sind die Klimaziele nicht zu schaffen.“
EnBW setzt auf Großspeicher und Gaskraftwerke
Ein Signalprojekt ist der geplante Großspeicher in Philippsburg, wo die EnBW eine Leistung von 400 MW und 800 MWh Kapazität realisieren will. Parallel will der Konzern jedoch auch in neue, wasserstofffähige Gaskraftwerke investieren. Voraussetzung dafür ist das geplante Kraftwerkssicherungsgesetz (KWSG), das Ende des Jahres in Kraft treten soll.
Kritik und Zukunftsperspektiven
Kritiker bemängeln hohe Kosten und kurze Lebensdauer von Batteriespeichern. Meyer widerspricht: „Batterien sind inzwischen deutlich günstiger. Was fehlt, sind standardisierte und einfache Vorgaben für die Netzanbindung.“
Klar ist: Ohne leistungsfähige Speicher bleibt die Energiewende labil. Längere Dunkelflauten lassen sich zwar nicht allein mit Batterien abfangen – dafür braucht es ergänzende Technologien wie Wasserstoffkraftwerke. Doch ohne einen massiven Ausbau von Speichern droht die deutsche Energiewende ins Stocken zu geraten.